Angriff im Einsatz: Retter haben oft schlechte Karten bei Schadenersatz
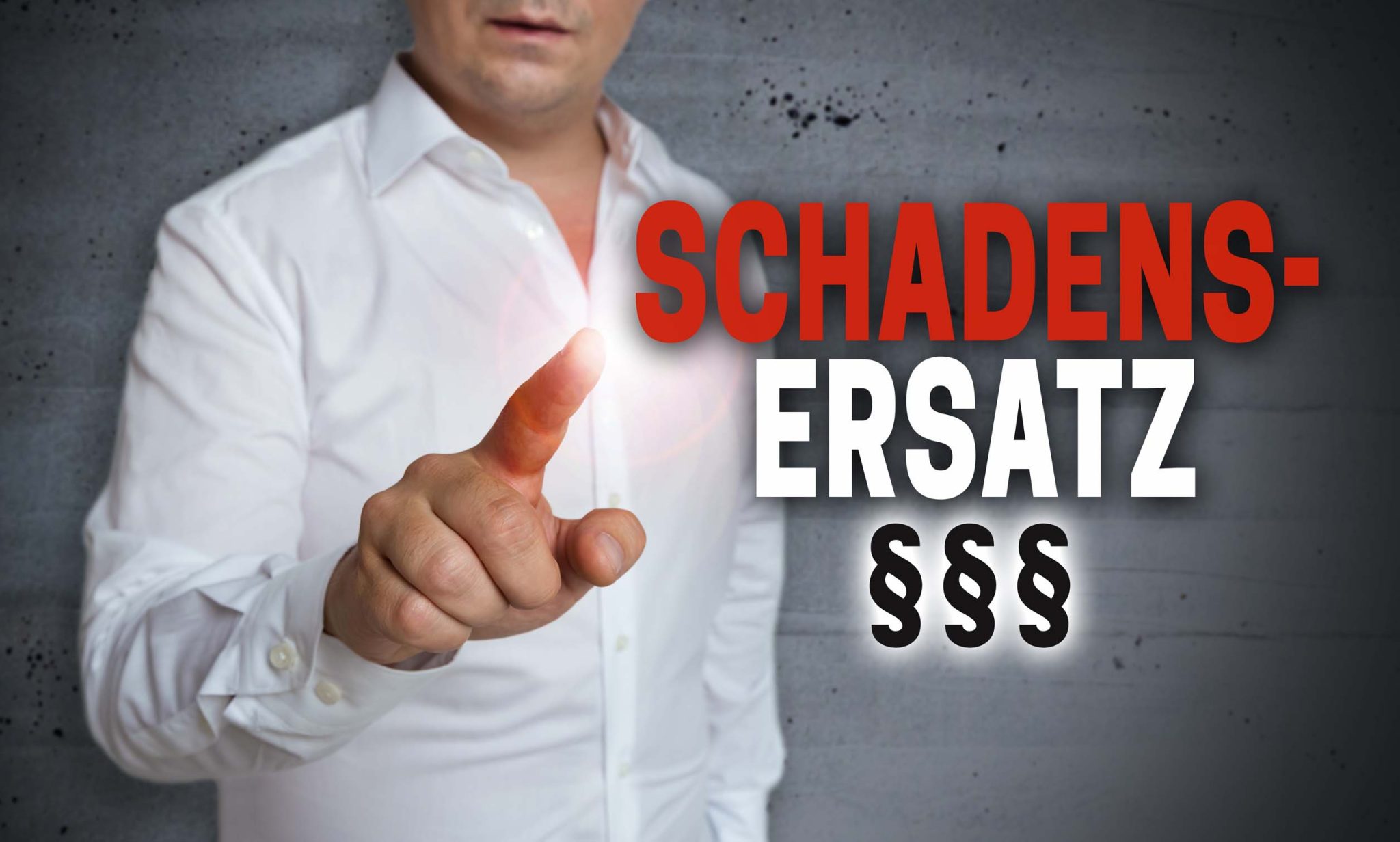 (Bild: wsf-s/Shutterstock)Ulm (lse) – Werden Rettungskräfte während eines Einsatzes Opfer von Gewalt, sind ihre Chancen auf Schadenersatz häufig gering. Das liegt nicht nur an rechtlichen Hürden, sondern auch an der wirtschaftlichen Lage vieler Täter. Das berichtet Bernd Spengler, Fachanwalt für Arbeitsrecht, in seiner Kolumne im aktuellen RETTUNGS-MAGAZIN, Ausgabe 5/2025.
(Bild: wsf-s/Shutterstock)Ulm (lse) – Werden Rettungskräfte während eines Einsatzes Opfer von Gewalt, sind ihre Chancen auf Schadenersatz häufig gering. Das liegt nicht nur an rechtlichen Hürden, sondern auch an der wirtschaftlichen Lage vieler Täter. Das berichtet Bernd Spengler, Fachanwalt für Arbeitsrecht, in seiner Kolumne im aktuellen RETTUNGS-MAGAZIN, Ausgabe 5/2025.
Ein Fall aus dem Rettungsdienst verdeutlicht das Dilemma: Ein Notfallsanitäter und ein 24-jähriger Rettungssanitäter werden zu einem Einsatz nahe eines Bahnhofs alarmiert. Anrufer hatten einen schlafenden Mann in einem Hauseingang gemeldet. Vor Ort treffen die Einsatzkräfte auf einen bewusstlosen, stark alkoholisierten und im Rettungsdienst bekannten Patienten. Als dieser plötzlich um sich tritt, wird der Rettungssanitäter schwer an der Hand verletzt. Die Verletzung erfordert eine Operation und führt zu mehreren Wochen Arbeitsunfähigkeit. Später kann der Betroffene nicht sofort an seinen alten Arbeitsplatz zurückkehren und muss vorübergehend in der Hausnotrufzentrale arbeiten – mit deutlichen Einkommenseinbußen.
Der Retter erstattet noch am selben Tag Anzeige, der Täter wird ermittelt, ein Strafverfahren eingeleitet. Parallel macht der Verletzte zivilrechtlich Ansprüche auf Schadensersatz und Schmerzensgeld geltend. Doch die Erfolgsaussichten solcher Verfahren sind häufig schlecht.
Viele Täter stehen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss
 (Bild: TheVisualsYouNeed/Shutterstock)Ein zentrales Problem ist die Zurechnungsfähigkeit. Viele Täter stehen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss oder befinden sich in einem medizinischen Ausnahmezustand. In solchen Fällen gelten sie oft als schuldunfähig im Sinne des Strafrechts oder deliktsunfähig nach Zivilrecht. Damit entfällt in vielen Fällen die Haftung. Bei über drei Promille wird Schuldunfähigkeit in der Regel angenommen, eine verminderte Schuldfähigkeit kann bereits ab zwei Promille bestehen. Auch schwere psychische Erkrankungen oder akute Krankheitszustände können dazu führen, dass die Betroffenen für ihre Handlungen nicht haftbar gemacht werden.
(Bild: TheVisualsYouNeed/Shutterstock)Ein zentrales Problem ist die Zurechnungsfähigkeit. Viele Täter stehen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss oder befinden sich in einem medizinischen Ausnahmezustand. In solchen Fällen gelten sie oft als schuldunfähig im Sinne des Strafrechts oder deliktsunfähig nach Zivilrecht. Damit entfällt in vielen Fällen die Haftung. Bei über drei Promille wird Schuldunfähigkeit in der Regel angenommen, eine verminderte Schuldfähigkeit kann bereits ab zwei Promille bestehen. Auch schwere psychische Erkrankungen oder akute Krankheitszustände können dazu führen, dass die Betroffenen für ihre Handlungen nicht haftbar gemacht werden.
Zwar kann ein selbstverschuldeter Rauschzustand nach Paragraf 827 Satz 2 BGB zur zivilrechtlichen Haftung führen, wenn die Handlung auch fahrlässig schadensersatzpflichtig wäre. In der Praxis spielen jedoch andere Faktoren eine noch größere Rolle: Viele Täter sind schlicht nicht zahlungsfähig. Vermögen oder Versicherungen fehlen häufig, nicht selten sitzen die Verursacher bereits kurz nach der Tat Freiheitsstrafen für andere Delikte ab. Selbst wenn Gerichte Schadenersatz oder Schmerzensgeld zusprechen, scheitert die Vollstreckung meist an der fehlenden Liquidität der Schädiger.
Mangelndes öffentliches Interesse
Auch strafrechtlich erleben betroffene Rettungskräfte oft Ernüchterung. Verfahren wegen Körperverletzung oder Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und gleichgestellte Personen werden nicht selten wegen mangelnden öffentlichen Interesses eingestellt. Für die Betroffenen bleibt das nicht nur schmerzlich, sondern auch finanziell folgenreich.
Fachleute fordern deshalb, über neue Absicherungssysteme nachzudenken. Diskutiert werden unter anderem gesetzliche Regelungen oder staatliche Fonds, die für Entschädigungen einspringen könnten, wenn Täter nicht leistungsfähig sind. Solche Modelle könnten helfen, strukturelle Lücken zu schließen und das Vertrauen der Einsatzkräfte in den Rechtsschutz zu stärken. Andernfalls droht sich bei vielen Rettern der Eindruck zu verfestigen, im Ernstfall rechtlich und finanziell schutzlos dazustehen.
Quelle: Rettungs-Magazin, September/Oktober-Ausgabe 2025.
Schlagwörter:
Rettungsdienst
Das könnte dich auch interessieren
“…werden nicht selten wegen mangelnden öffentlichen Interesses eingestellt.” ist für mich im Rettungsdienst ein unfassbar nicht wertschätzender Zustand!!! Da läuft in der Gesellschaft deutlich etwas falsch.